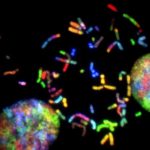I.
Als der programmatische Aufsatz Totalität1 1914 erschien, löste er keine erkennbare Reaktion aus.2 Ein Grund dafür dürfte die Dunkelheit und Komplexität des vom Autor Carl Einstein entwickelten ästhetischen Konzepts der Totalität3 sein. Neben dem Erstlingswerk Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders begründet dieser Text den Topos der Schwerverständlichkeit und Hermetik4 der Werke des im Schatten des Nationalsozialismus lange Zeit vergessenen Schriftstellers, Kunstkritikers und Publizisten. Über das Fragmentarische und die Offenheit der Form5 hinaus sind es die vielfältigen literarischen und philosophischen Traditionsbezüge der Texte Einsteins, die die Forschung zu intertextuellen Untersuchungen veranlasst haben.6 Doch gleichwohl behauptet werden kann, dass der geistesgeschichtliche Hintergrund, vor dem sich die Ästhetik Einsteins formiert, in verschiedenen Arbeiten sehr ausführlich dargestellt worden ist,7 gilt, dass die zentrale Bedeutung und Eigenart der Kant-Rezeption des frühen Einstein bislang nicht herausgearbeitet wurde.8 Es ist nicht nur zu zeigen, in welchem Umfang Einstein sein ästhetisches Konzept der Totalität in der Auseinandersetzung mit Kant entwickelt hat, sondern auch dass dieser in bestimmten Punkten Einsteins Poetik angeregt hat, wie sie uns in dem auf die Dadaisten vorausweisenden Bebuquin begegnet, der heftige und vor allem abwehrende Reaktionen auslöste,9 der aber gleichwohl nicht nur verrissen, sondern auch als „die letzte Konsequenz moderner zivilisatorischer Denkweise …, die völlige Loslösung vom Stofflichen, … zur Kunst umgewandelte Logik, Philosophie“ (W1 503) gefeiert wurde. Inwieweit trifft also die weitgehend ignorierte Meinung des mit Einstein befreundeten Ewald Wasmuth zu, dessen Denken habe „im Banne des deutschen Idealismus, des das Denken seinerzeit beherrschenden Subjektivismus“10 gestanden?
II.
In Hinblick auf die Chronologie der Publikationen Einsteins erscheint es sinnvoll, mit der Kritik an Kant zu beginnen, die schon in dem 1907 publizierten 4. Kapitel des Bebuquin11 enthalten ist. Sie wird von der Figur Nebukadnezar Böhm im Gespräch mit der Hauptfigur Bebuquin vorgetragen:
Lassen Sie sich nicht von einigen mangelhaften Philosophen täuschen, die fortwährend von der Einheit schwatzen und den Beziehungen aller Teile aufeinander, ihrem Verknüpftsein zu einem Ganzen. Wir sind nicht mehr so phantasielos, das Dasein eines Gottes zu behaupten. Alles unverschämte Einbiegen auf eine Einheit appelliert nur an die Faulheit der Mitmenschen. (…) Hinter eines kam ich seit meinem seligen Abscheiden. Sie sind Phantast, weil Sie nicht genug können. Das Phantastische ist gewiß ebenso Stoff- wie Formfrage. Aber vergessen Sie eines nicht. Phantasten sind Leute, die nicht mit einem Dreieck zu Ende kommen. (…) Hüten Sie sich vor quantitativen Experimenten. In der Kunst ist die Zahl, die Größe ganz gleichgültig. Wenn sie eine Rolle spielt, so ist sie bestimmt abgeleitet. Mit der Unendlichkeit zu arbeiten, ist purer Dilettantismus. Hier gebe ich Ihnen noch einen Ratschlag, der Sie später vielleicht anregt. Kant wird gewiß eine große Rolle spielen. Merken Sie sich eins. Seine verführerische Bedeutung liegt darin, dass er Gleichgewicht zustande brachte zwischen Objekt und Subjekt. Aber eines, die Hauptsache, vergaß er: was wohl das Erkenntnistheorie treibende Subjekt macht, das eben Objekt und Subjekt konstatiert. Ist das wohl ein psychisches Ding an sich?12
Als einen der mangelhaften Philosophen, die fortwährend von der Einheit schwatzen und denen Böhm unterstellt, so phantasielos gewesen zu sein, „das Dasein eines Gottes zu behaupten“, können wir Kant identifizieren. In der Kritik der reinen Vernunft etwa behauptet er jedoch nicht das Dasein eines Gottes, sondern stellt ein „Ideal des höchsten Wesens“ als das regulative Prinzip vor,
alle Verbindungen in der Welt so anzusehen, als ob sie aus einer allgenugsamen notwendigen Ursache entspränge, um darauf die Regel einer systematischen und nach allgemeinen Gesetzen notwendigen Einheit in der Erklärung derselben zu gründen (KrV B 647).13
Und auch in der Kritik der Urteilskraft gilt Gott als das Wesen, das als immerhin mögliche Ursache der Dinge der Natur mitgedacht werden muss:
Es bleibt also schlechterdings ein nur auf subjektiven Bedingungen, nämlich der, unseren Erkenntnisvermögen angemessenen reflektierenden Urteilskraft, beruhender Satz, der, wenn man ihn als objektiv-dogmatisch geltend ausdrückte, heißen würde: Es gibt einen Gott; nun aber, für uns Menschen, nur die eingeschränkte Formel erlaubt: Wir können uns die Zweckmäßigkeit, die selbst unserer Erkenntnis der inneren Möglichkeit vieler Naturdinge zum Grunde gelegt werden muss, gar nicht anders denken …, als indem wir sie und überhaupt die Welt uns als ein Produkt einer verständigen Ursache (eines Gottes) vorstellen. (KU § 75, 336f)
Trotz allgemeiner Gesetze der Natur könnten deren mannigfaltigen Formen heterogen sein, so dass kein „durchgängiger Zusammenhang empirischer Erkenntnis zu einem Ganzen der Erfahrung“ (KU XXXIII) und auch kein Handeln nach Vernunftgesetzen möglich wäre. Deshalb nimmt Kant ein a priorisches Prinzip an, welches eine Einheit der Natur trotz der Mannigfaltigkeit ihrer Formen und Gesetze zu denken erlaubt und die, anders als die Verstandeseinheit, als zufällig erscheint. Seine „Phantasielosigkeit“ besteht also weniger darin, wie Einstein es Böhm formulieren lässt, das „Dasein eines Gottes“ (Be 12) zu behaupten, sondern darin, diesen als notwendige Ursache und Grund der möglichen Einheit des Mannigfaltigen zu denken.
Böhms Spott indes zielt über diesen Kunstgriff hinaus. Denn mit den verhöhnten Phantasten, die mit einem Dreieck nicht zu Ende kommen, ist gleichfalls Kant angesprochen. Das Dreieck-Beispiel nimmt unter den Beispielen Kants eine Vorrangstellung ein. Die Tatsache, dass sich ein Dreieck, ohne dass eine empirische Anschauung von ihm vorauszusetzen wäre, a priori in der Anschauung geben und sich auf dieser ein synthetischer Satz gründen lässt, zeige, dass der Raum, genau wie die Zeit, eine reine, a priorische Form sinnlicher Anschauung ist.14 Für Kant sind beide „die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere Anschauung möglich ist”. Und die grundlegende „Form aller Erscheinungen (ist) vor allen wirklichen Wahrnehmungen, mithin a priori im Gemüte gegeben“, und zwar als „reine Anschauung“ (KrV B 42). Diese Auszeichnung des transzendentalen Subjekts mit Raum und Zeit als Formen a priori ermöglichte Kant, „dass er Gleichgewicht zustande brachte zwischen Objekt und Subjekt.“ (Be 13) Daran ist allerdings schwer zu verstehen, in welchem Sinn eine reine Anschauung, die eine unsere Sinnlichkeit übersteigende und daher letztlich intellektuelle Vorstellung einer sukzessiven Addition von gleichartigen Teilen des Raumes bzw. der Zeit bis ins Unendliche ist, die Bedingung der empirischen Anschauung sein soll. So scheint Böhms polemischer Kommentar – „Mit der Unendlichkeit zu arbeiten, ist purer Dilettantismus“ (Be 12) –, auch auf das von Kant behauptete Apriori von Raum und Zeit zu zielen. Denn als reine Anschauungen denkt Kant sie als quantitativ und unendlich. Nun sagt er aber nicht etwa, dass die Empfindung oder die Erkenntnis von Raum und Zeit für jedes Lebewesen subjektiv ist, oder dass nur der Mensch unter ihnen fähig ist, sich diese a priori und als unendlich vorzustellen. Nein, Kant begreift Raum und Zeit ausschließlich als subjektive, menschliche Erkenntnisbedingungen. Deshalb sollen sie „gar keine Eigenschaft irgend einiger Dinge an sich“ (KrV B 42) vorstellen können. Und deswegen stattet er Gott mit der Freiheit von beschränkender Sinnlichkeit und Denken aus, da diese sonst auch als Bedingungen seiner Existenz gelten müßten.15 So ist Gott der Meister des Wunders, denn seine Anschauung ist eine ursprüngliche, „durch die selbst das Dasein des Objekts der Anschauung gegeben wird (und die, so viel wir einsehen, nur dem Urwesen zu kommen kann)“ (KrV B 72). Die „Dilettanten des Wunders“ können als eine Parodie auf diesen Gott verstanden werden, etwa wenn es von Bebuquin heißt:
Seit Wochen starrte Bebuquin in einen Winkel seiner Stube, und er wollte den Winkel seiner Stube aus sich heraus beleben. Es graute ihm, auf die unverständlichen, niemals endenden Tatsachen angewiesen zu sein, die ihn verneinten. Aber sein erschöpfter Wille konnte nicht ein Stäubchen erzeugen, er konnte mit geschlossenen Augen nichts sehen. „Es muss möglich sein, genau wie man früher an einen Gott glauben konnte, der die Welt aus nichts erschuf …“ (Be 12)
Doch nicht nur die „Dilettanten des Wunders“, sondern der Mensch überhaupt unterliegt der Bedingung einer stets beschränkten Sinnlichkeit und ist auf die Affizierung durch Gegenstände angewiesen, deren Wirkung auf die Vorstellungsfähigkeit bei Kant Empfindung16 heißt und die für ihn als „Dinge an sich“ unabhängig vom menschlichen Erkennen und unerkennbar sind.
III.
In seinem Aufsatz Totalität rekombiniert und verfremdet Einstein Theoreme Kants und baut sie in sein dort entwickeltes ästhetisches Konzept ein. Da Einstein den Begriff der Totalität anders als Kant dazu verwendet, sowohl eine allgemeine Formbestimmung von Kunstwerken17 als auch eine sich damit verwebende Bestimmung des die Kunstproduktion wie -rezeption bedingenden psychischen Prozesses durchzuführen, ist die Rede von einem Begriff problematisch. Totalität ist unter dem letzten Gesichtspunkt nur Name für die Phänomene des Psychischen und des Gedächtnisses, von denen Einstein weiß, dass sie sich begrifflich nicht definitiv fassen lassen.18
Die erste Spur einer Kantlektüre im Aufsatz Totalität ist „der Begriff des qualitativen Urteils“, das, wie es dort heißt, „nicht intellektuell ist, vielmehr von den Elementen der Form auszugehen hat“ (W1 224). Kant spricht in der Kritik der Urteilskraft von einer Erklärung des Schönen nach seinen verschiedenen Momenten, die der Kategorientafel in der Kritik der reinen Vernunft entsprechen. So bezieht sich das erste Moment auf die „Qualität“ des ästhetischen Urteils. Eigentlicher Zielpunkt ist dabei die Qualifizierung des subjektiven Zustandes, der einer „reinen“ Äußerung des Geschmacks adäquat sein soll. Kant definiert Geschmack als „das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder Mißfallen, ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön.“ (KU § 5, 16) In § 12 verneint Kant die Frage, ob es Vorstellungen gibt, die a priori einen Zustand des Subjekts als Lust oder Unlust bestimmen. Die Empfindung, worunter in diesem Kontext das Gefühl der Lust oder Unlust zu verstehen ist, soll nicht hervorgerufen werden durch die sinnliche Wirkung oder die Vorstellung eines Objekts a priori. Da damit die materielle Existenz des Objekts gleichgültig bleibt, ist es für Kant die Reflexion einer Gegenstandsform, die eine höhere Lust als Wirkung hat. Die materiellen Elemente der Empfindungen, wie Farben und Töne, scheinen so subjektiv und verschieden empfunden zu werden, dass sie nicht als dasjenige fungieren können, dessen ästhetische Reflexion Lust erzeugt, deren Allgemeinheit anderen angesonnen werden könnte, wie dies bei der Reflexion auf eine Gegenstandsform möglich sein soll. Deswegen stellt Kant fest:
In der Malerei, Bildhauerkunst, ja allen bildenden Künsten, in der Baukunst, Gartenkunst, sofern sie schöne Künste sind, ist die Zeichnung das Wesentliche, in welcher nicht, was in der Empfindung vergnügt, sondern bloß, was durch seine Form gefällt, den Grund aller Anlage für den Geschmack ausmacht. (KU § 14, 42)
Nicht erst der im Aufsatz Totalität überall formulierte Primat der Form zeugt davon, dass Einstein Kants Ansatz übernommen hat. Wir finden ihn schon in einem Aufsatz über Arnold Waldschmidt19 aus dem Jahr 1910:
Die Farbe, der optische Reiz, das Materielle ist dem Konstruktiven, … untergeordnet, Waldschmidt gibt das harte Gesetz der innerlich geschauten Kontur, das mit seiner seelischen Objektivität, mit der Wahrheit der Form überwältigt. (W1 38)
Auch die folgende Passage bezieht sich auf die Kritik der Urteilskraft:
Dies ist eines der bedeutendsten Mittel der Waldschmidt´schen und jeder Kunst, die Totalität der materiellen Fläche durch vollkommene Formung nach allen Seiten zum Kunstwerk zu bilden, den Blick ewig im Umlauf in sich hineinzuziehen. Dieser unaufhörliche Zwang auf das Auge des Betrachters, die wohlabgewogene Bedeutung jeden Punktes macht große und monumentale Kunst aus. (W1 40)
Einstein attestiert Waldschmidts Kunst eine Wirkung, die der analog ist, die das Naturschöne auf die Einbildungskraft hat. Sie wird zu einer, „die in Beobachtung der Gestalt gleichsam spielt“ (KU 50). Und als produktive und spontane wird sie zur „Urheberin willkürlicher Formen möglicher Anschauungen“ (KU 69).
Im Aufsatz Totalität gibt es neben dem Begriff des „qualitativen Urteils“ mehrere Hinweise auf die Kritiken Kants. So führen die von Einstein verwendeten Metaphern des Organischen gleichfalls zur Kritik der Urteilskraft, vor allem zum Begriff der organisierten Wesen, der genau wie der Geniebegriff nicht direkt thematisiert wird. Der Begriff der Totalität und die Begriffe der extensiven und intensiven Größe hingegen werden von Kant in der Kritik der reinen Vernunft behandelt. Ich gehe zunächst den Metaphern des Organischen nach.
Einstein begreift das Erkennen, womit er nicht nur ein logisches, sondern vor allem ein ästhetisches meint, als Schaffen totaler Gegenstände, die er auch als „konkrete Organismen“ bezeichnet. Bereits in dem Aufsatz über Waldschmidt verwendet er die Metapher des Organischen. Waldschmidt konzentriere in seinen graphischen Werken „die organische Form“ (W1 38):
Nichts erinnerte hier an Natur, kein Strich ist unmittelbar vom Modell hereingenommen und darum ist dies Werk vollendeter Totalorganismus, der auf nichts Außenstehendes hinweist. (W1 39)20
Auffällig ist hier, neben der Absage an ein traditionelles Konzept der Mimesis, die Auszeichnung des Kunstwerks als Organismus, der aber auf nichts Außenstehendes hinweise. Diese Heautonomie des Kunstwerks, das an sich gesetzmäßig, transzendent und organisiert sein soll, leitet sich unmittelbar von Kants Bestimmungen der organisierten Wesen als Naturzweck ab:21
In einem solchen Produkte der Natur wird ein jeder Teil so, wie er nur durch alle übrige da ist, auch als um der andern und des Ganzen willen existierend, d.i. als Werkzeug (Organ) gedacht: welches aber nicht genug ist (denn er könnte auch Werkzeug der Kunst sein, und so nur als Zweck überhaupt möglich vorgestellt werden); sondern als ein die andern Teile (folglich jeder den andern wechselseitig) hervorbringendes Organ, dergleichen kein Werkzeug der Kunst, sondern nur der allen Stoff zu Werkzeugen (selbst denen der Kunst) liefernden Natur sein kann: und nur dann und darum wird ein solches Produkt, als organisiertes und sich selbst organisierendes Wesen, ein Naturzweck genannt werden können. (KU § 65, 291f)
Die Bestimmung der organisierten Wesen als organisiertes und sich selbst organisierendes Seiendes ist bei Einstein eine Bestimmung der Totalität. Er spricht von einer „konkrete(n) Totalität, die nicht durch ein außenliegendes Instrument eine Ordnung oder Gliederung erfahren kann, sondern die an sich schon organisiert ist.“ (W1 226) Darüber hinaus wird hier deutlich, dass noch ein weiteres Kriterium der organisierten Wesen für Totalität gelten soll, die Freiheit von einer „Kausalität der Begriffe von vernünftigen Wesen außer ihm“, dem Naturprodukt (KU 289). Totalität könne „nicht durch ein außenliegendes Instrument eine Ordnung oder Gliederung erfahren“, und auch nicht durch eine Ursache, die immer „in einer anderen, postumen Ebene als der Gegenstand selbst“ (W1 228) liege. Eine Bedingung dieser Freiheit von einer äußerlichen Ursache ist, „dass die Teile (ihrem Dasein nach und der Form nach) nur durch ihre Beziehung auf das Ganze möglich sind“ (KU 289), dass sie sich „dadurch zur Einheit eines Ganzen verbinden“ (KU 291). Diese Bedingung soll als Formbestimmung totaler Gegenstände ermöglichen, „dass wir an jedem beliebigen Punkte unserer Erlebnisse diese wie ein Ganzes betrachten“ (W1 228) können.22 Und die Bestimmung, dass „Totalität als endliches System nur unter der Mitwirkung aller bestimmten, verschieden gearteten Teile eines Systems da ist“ (W1 227), macht Totalität als endliches Ganzes von der Mitwirkung aller Teile abhängig. Ihre Formulierung, dass Totalität „da ist“, zeigt aber auch, dass sie die oben bereits vollständig zitierte Definition der organisierten Wesen zur Vorlage hat:
In einem solchen Produkte der Natur wird ein jeder Teil so, wie er nur durch alle übrige da ist, auch als um der andern und des Ganzen willen existierend … gedacht (KU 291).
Mit den Metaphern des Organischen bezeichnet Einstein sowohl Eigenschaften des Gedächtnisses als auch des Kunstwerks. Er führt die Bezeichnung der Teile organisierter Wesen als „Organ“, aber auch den Begriff des „organisierten Wesens“, in verschiedenen Verwendungsweisen einer Totalisierung zu. Es ist die Rede von Kunstwerken als „organischer Form“, „Totalorganismen“ (W1 38f.), „individuellen Organismen“, „Lebewesen“ (W1 227), aber auch den „Teilen“ des Kunstwerks als „symbolisierten Organe(n)“, die „auseinander hervorgehen“ (W1 30). Diese Metaphern haben indes nicht nur die Aufgabe, auf dessen psychischen, dynamischen Ursprung zu verweisen. Sie antizipieren genauso die Wirkung, die es durch seine „Form“, durch die Organisation seiner „Elemente“ und „Inhalte“ auf den Rezipienten haben sollen. Wie Einstein weiß, ist das Kunstwerk als Realgegenstand so leblos wie jeder anorganische Gegenstand.23 Ist der „totale“ ästhetische Gegenstand aber, wie Einstein will, (Todes-)Form des psychischen Prozesses, aus dem er hervorging, erhält sich seine (He-)Autonomie aufgrund einer dem Gedächtnis analogen Organisation. Die für sich genommen „leblose“ Autonomie des Kunstwerks soll im Rezipienten einen neuen „autonomen“ Prozess anstoßen. So erwartet sich Einstein vom „Kunstschönen“ eine Wirkung, die der des „Naturschönen“ bei Kant vergleichbar ist, ohne deren Begriffe je fallen zu lassen. Er disqualifiziert die Natur als Modell der Kunst, postuliert eine „Mimesis“ nicht der Gegenstände der Außenwelt, sondern unserer inneren subjektiven Wahrnehmung und Empfindung. Insoweit hat Kant einen entscheidenden Eindruck bei Einstein hinterlassen: der Mensch ist nicht das Maß der Dinge an sich, sondern nur des menschlichen Wahrnehmens und Erkennens.
IV.
Einstein leitet aus der Definition der organisierten Wesen, die Kant in der Kritik der Urteilskraft bietet, die Formbestimmungen totaler Gegenstände und die Organisation des Gedächtnisses ab. Doch die Prozessualität von Empfinden, Wahrnehmen, Erkennen und seinen Begriff einer qualitativen Zeit entwickelt er in einer Auseinandersetzung mit der Kritik der reinen Vernunft. Einstein stellt fest: „Totalität (…) hat als Intensität nichts mit der extensiven Größe des räumlich Unendlichen zuschaffen“ (W1 227). Wir begegnen hier dem Begriff der Intensität, der durch eine Reihe von Verschiebungen hindurch wechselseitig mit dem Begriff der Qualität entwickelt wird, und dem der „extensiven Größe“, den Kant in den „Axiomen der Anschauung“ definiert. Dort bestimmt Kant alle Erscheinungen in der Anschauung als extensive Größen:
die Wahrnehmung eines Objekts, als Erscheinung, (ist) nur durch dieselbe synthetische Einheit des Mannigfaltigen der gegebenen sinnlichen Anschauung möglich, wodurch die Einheit der Zusammensetzung des mannigfaltigen Gleichartigen im Begriffe einer Größe gedacht wird; d.i. die Erscheinungen sind insgesamt Größen, und zwar extensive Größen, weil sie als Anschauungen im Raume oder der Zeit durch dieselbe Synthesis vorgestellt werden müssen, als wodurch Raum und Zeit überhaupt bestimmt werden. (KrV B 203)
Genau von diesem Begriff einer synthetischen Einheit „des mannigfaltigen Gleichartigen im Begriff einer extensiven Größe“ stößt sich Einsteins gegen Kants Begriff der Totalität gerichtetes Konzept ab:
Totalität ist nicht Einheit; denn diese bedeutet stets Wiederholung, und zwar Wiederholung ins quantitativ Unendliche; während Totalität als endliches System nur unter der Mitwirkung aller bestimmten, verschieden gearteten Teile eines Systems da ist. (W1 227)
Für Einstein gilt, dass totale Gegenstände, worunter er Gegenstände der Natur, der Kunst oder des Gedächtnisses begreift, nicht unter die Einheit einer extensiven Größe gebracht werden können. Ihre endliche formale Organisation verschieden gearteter Teile soll eine synthetische Einheit ausschließen, wie sie im Begriff der extensiven Größe gedacht ist. Totalität sei eine synthetische Einheit von Verschiedenartigem. Kant hingegen führt die Auszeichnung von Raum und Zeit als reine Anschauung a priori zu der Feststellung, dass die unbestimmten Gegenstände einer empirischen Anschauung in der Synthesis des Mannigfaltigen nur als Gleichartiges zusammengesetzt werden können. Genauso soll sich die Vorstellung der Unendlichkeit des Raums aus der Addition gleichartiger Räume ergeben. Und in gleicher Weise denkt sich Kant in der Zeit
den sukzessiven Fortgang von einem Augenblick zum andern, wo durch alle Zeitteile und deren Hinzutun endlich eine bestimmte Größe erzeugt wird. Da die bloße Anschauung an allen Erscheinungen entweder der Raum oder die Zeit ist, so ist jede Erscheinung als Anschauung eine extensive Größe, indem sie nur durch sukzessive Synthesis (von Teil zu Teil) in der Apprehension erkannt werden kann. Alle Erscheinungen werden demnach schon als Aggregate (Menge vorhergegebener Teile) angeschaut, welches eben nicht der Fall bei jeder Art Größen, sondern nur deren ist, die uns extensiv als solche vorgestellt und apprehendiert werden. (KrV B 204)
Die hier im letzten Satz nur angedeutete „intensive Größe“, die nicht „vorgestellt und apprehendiert“ wird, ist für Einstein deswegen von herausragender Bedeutung, weil er mit ihr seine Theorie eines qualitativen Erlebens der Zeit entwickelt, das, anders als bei Kant, als Bedingung einer bewussten, aber zwangsläufig rückblickenden Zeitvorstellung erscheint. Im Kapitel „Antizipationen der Wahrnehmung“ spezifiziert sich nicht nur der für diese Theorie wichtige Begriff der Empfindung, sondern genauso finden sich bei Kant selbst Anhaltspunkte einer Erklärung der Erzeugung einer extensiven Zeitgröße in der Apprehension, die Einstein zu der Theorie einer vorgelagerten und bedingenden intensiven Zeitempfindung veranlassen.
Kant macht die Möglichkeit der „Vorstellung eines Objekts“ abhängig vom „Bewusstsein des mannigfaltigen Gleichartigen in der Anschauung überhaupt“ (KrV B 203). Einstein hingegen setzt eine psychische Totalität als Bedingung der Vorstellung eines Objekts an:
Wir wären nie imstande, Bestimmtes vorzustellen und zu bestimmen, wenn unser Gedächtnis nicht die Vereinigung prägnanter qualitativer Gebilde darstellte, ohne die (…) die Zeit für uns nie Unterschiede enthalten könnte. (W1 227)
Ausgehend von der Apprehension, deren Maß die Zahl ist „als die Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen einer gleichartigen Anschauung überhaupt, dadurch, dass ich die Zeit selbst in der Apprehension der Anschauung erzeuge“ (KrV B 182), gelangt Einstein zu der Frage nach dem Zusammenhang von Gedächtnis und „Zeiterzeugung”. Für ihn gilt:
Das Gedächtnis ist eine reine Funktion qualitativ verschiedener Erlebnisse, die ihrer Qualität nach untergeordnet werden und simultan latent sind, um zu agieren innerhalb eines qualitativen Erlebnisses, das Entsprechendes oder Entgegengesetztes hineinnimmt. (W1 228)
Einsteins Begriff des qualitativen Erlebnisses leitet sich von Kants Begriff der Empfindung ab, die eine intensive Größe hat. Kant stellt fest, dass Empfindung keine objektive Vorstellung sei und da in ihr keine
Anschauung vom Raum, noch von der Zeit, angetroffen wird, so wird ihr zwar keine extensive, aber doch eine Größe (und zwar durch die Apprehension derselben, in welcher das empirische Bewusstsein in einer gewissen Zeit von nichts= 0 bis zu ihrem gegebenen Maße erwachsen kann), also eine intensive Größe zu kommen, welcher korrespondierend allen Objekten der Wahrnehmung so fern diese Empfindung enthält, intensive Größe, d.i. ein Grad des Einflusses auf den Sinn beigelegt werden muss. (KrV B 208)
Vernachlässigen wir zunächst, dass Kant sowohl den Empfindungen als auch den ihr korrespondierenden Objekten intensive Größe beilegt. Versuchen wir zuerst nachzuvollziehen, wie sich mit Hilfe seiner Ausführungen eine Hypothese über die Erzeugung der Zeit bilden lässt. Kant bedient sich des Kunstgriffs, die Apprehension, also die sukzessive Aufnahme des Mannigfaltigen der Erscheinungen in die Synthesis der Einbildungskraft, zu atomisieren, indem er sie in Augenblicke der Empfindung zerlegt:
Die Apprehension, bloß vermittels der Empfindung, erfüllet nur einen Augenblick … Als etwas in der Erscheinung, dessen Apprehension keine sukzessive Synthesis ist, die von Teilen zur ganzen Vorstellung fortgeht, hat sie also keine extensive Größe; der Mangel der Empfindung in demselben Augenblicke würde diesen als leer vorstellen, mithin =0. Was nun in der empirischen Anschauung der Empfindung korrespondiert, ist Realität …; was dem Mangel derselben entspricht, Negation = 0. (KrV B 210)
Kant gibt dann ein für die Frage nach der Erzeugung der Zeit sehr aufschlussreiches Beispiel:
Wenn man diese Realität als Ursache (es sei der Empfindung oder anderer Realität in der Erscheinung, z.B. einer Veränderung,) betrachtet; so nennt man den Grad der Realität als Ursache, ein Moment, z.B. das Moment der Schwere, und zwar darum, weil der Grad nur die Größe bezeichnet, deren Apprehension nicht sukzessiv, sondern augenblicklich ist. (KrV B 210)
Damit scheint klar zu sein, dass das Mannigfaltige der Erscheinungen in der sukzessiven Aufnahme in die Synthesis der Einbildungskraft augenblicklich apprehendierte Empfindungen intensiver Größe sein sollen bzw. die ihnen korrespondierende Realität. Doch in der anschließenden „Ersten Analogie“ setzt Kant eine beharrliche Substanz als „Substrat alles Realen“ an. Dieses Beharrliche sei an den
Erscheinungen das Substratum aller Zeitbestimmungen, folglich auch die Bedingung der Möglichkeit aller synthetischen Einheit der Wahrnehmungen, d.i. der Erfahrung, und an diesem Beharrlichen kann alles Dasein und aller Wechsel in der Zeit nur als ein Modus der Existenz dessen, was bleibt und beharrt angesehen werden. (KrV B 226)
Allein durch die beharrliche Substanz sei eine empirische Vorstellung der Zeit in der Apprehension möglich, „bekommt das Dasein in verschiedenen Teilen der Zeitreihe nach einander eine Größe, die man Dauer nennt.“ (KrV B 226) Mit seinem Begriff der beharrlichen Substanz kann Kant nur eine schwache Erklärung der Erzeugung der Zeitvorstellung geben, denn letztlich, wenn auch durch eine Reihe von Zwischenschritten vermittelt, ist er lediglich eine Reformulierung seines Begriffs der Zeit als reiner Anschauung a priori.24 So wird Zeit erneut nur als extensive Größe gedacht. Einstein entwickelt demgegenüber eine Theorie der Empfindung der Zeit, die Kants Konzept der beharrlichen Substanz hinter sich lässt und die Empfindung des „Verfließens“ von Zeit von der Empfindung verschiedener Realitäten intensiver Größe abhängig macht, wie Kant sie definiert. Kant selbst liefert das Stichwort, wenn er über die intensiven Größen sagt, man könne sie
auch fließende nennen, weil die Synthesis (der produktiven Einbildungskraft) in ihrer Erzeugung ein Fortgang in der Zeit ist, deren Kontinuität man besonders durch den Ausdruck des Fließens (Verfließens) zu bezeichnen pflegt. (KrV B 211)
Nach Kant können wir uns die Zeit
nicht anders vorstellig machen …, als unter dem Bilde einer Linie, so fern wir sie ziehen, ohne welche Darstellungsart wir die Einheit ihrer Abmessung gar nicht erkennen könnten, imgleichen dass wir die Bestimmung der Zeitlänge, oder auch der Zeitstellen für alle innere Wahrnehmungen, immer von dem hernehmen müssen, was uns äußere Dinge Veränderliches darstellen (KrV B 156).
Einstein kann sich auf die von Kant vorgestellte augenblickliche Apprehension eines oder verschiedener Gegenstände vermittels der Empfindung berufen, deren wechselnde intensive Größe, d.h. für Einstein unterschiedliche Qualität, in einer Reihe von Augenblicken dann die Empfindung eines Verfließens der Zeit konstituiere. Die intensiven Größen verschiedener Empfindungen sollen den qualitativen „Unterschied der Erlebnisse“ ausmachen, „der allegorisch an Hand geometrischer Vorstellungen betrachtet, räumliche Folge bedeutet, während Zeit nur Unterschied der Qualität ist.“ (W1 227) Das Gedächtnis gilt entsprechend als „die Vereinigung prägnanter qualitativer Gebilde“, also von Empfindungen intensiver Größe, ohne die „die Zeit für uns nie Unterschiede enthalten könnte.“ (W1 227)
Daß Einstein seine Theorie der qualitativen Zeit in einer Auseinandersetzung mit dem Kapitel „Antizipationen der Wahrnehmung“ entwickelt, lässt sich auch an der Übernahme von Formulierungen zeigen. Kant stellt fest:
Nun ist aber jede Empfindung einer Verringerung fähig, so dass sie abnehmen, und so allmählich verschwinden kann. Daher ist zwischen Realität in der Erscheinung und Negation ein kontinuierlicher Zusammenhang möglicher Zwischenempfindungen, deren Unterschied voneinander immer kleiner ist, als der Unterschied zwischen der gegebenen und dem Zero, oder der gänzlichen Negation. Das ist: das Reale in der Erscheinung hat jederzeit eine Größe, welche aber nicht in der Apprehension angetroffen wird, indem diese vermittelst der bloßen Empfindung in einem Augenblick und nicht durch sukzessive Synthesis vieler Empfindung geschieht (KrV B 210)
In dem folgenden Passus übernimmt Einstein nicht nur die Formulierung, dass die intensive Größe abnehmen, sondern auch die, dass ihre Empfindung nur in einem Augenblick geschehen könne, wie Kant am Beispiel der Schwere gezeigt hat. Totalität erweise eine bis ins kleinste gegliederte Zeitfolge, „deren Intensität bald zu-, bald abnimmt, je nach Art der Intensität der Erlebnisse und in jedem Augenblick tatsächlich beginnen kann.“ (W1 228) Weil sich für Einstein die Empfindung der Zeit aus Empfindungen verschiedener intensiver Größe zusammensetzt, disqualifiziert er die Vorstellung eines Zeitraums extensiver Größe als Darstellungsmittel zeitlicher Prozesse:
Da das Quantitative nichts Neues erzeugen kann, sondern nur die Wiederholung einer Einheit darstellt, so kann es niemals als Darstellungsmittel irgendwelcher zeitlicher Prozesse benutzt werden, außer wenn diese selbst rein quantitativer Art sind, d.h. man wiederholt rückschließend einen Prozess, was jedoch im unmittelbaren Leben uns unmöglich erscheint, denn die zeitliche Anschauung stellt immer eine neue Konstellation dar. (W1 229)
Für Einstein ist die intensive Größe der Empfindung und der ihr korrespondierenden Realität eine Qualität. Das Erlebnis des Unterschieds verschiedener Qualitäten soll die Empfindung des Verfließens von Zeit konstituieren. Deswegen sagt er, Zeit sei „unmittelbar Differenz der Qualität“ (W1 228).25 Er verwirft die quantitative Betrachtung, da diese „niemals qualitativ bestimmt werden darf, was eine Begrenzung ausschließt“ (W1 229). Das Stichwort „Begrenzung“ verweist dabei unmittelbar auf die Kategorien der Qualität in der Kritik der reinen Vernunft: Realität, Negation und Limitation.26 Im Kapitel „Von den reinen Verstandesbegriffen“ heißt es, dass „die Einschränkung nichts anders als Realität mit Negation verbunden“ (KrV B 111) sei. In dieser Definition der Limitation können wir Einsteins Definition der Totalität erkennen, soweit sie sich aus der Kritik der reinen Vernunft ableitet. Dort ist Totalität allerdings eine quantitative Kategorie. Die „Allheit (Totalität)“ ist nichts anders als „die Vielheit als Einheit betrachtet“ (KrV B 111). Neben den positiven Bestimmungen der Totalität, die Einstein der Definition der organisierten Wesen in der Kritik der Urteilskraft entnimmt, sind alle Bestimmungen der Totalität, soweit sich aus der Kritik der reinen Vernunft ableiten, Negationen oder Umkehrungen der Definitionen Kants: „Totalität macht, dass das Ziel jeder Erkenntnis und Bemühung nicht mehr im Unendlichen liege, als undefinierbarer Gesamtzweck, vielmehr im einzelnen beschlossen ist“ (W1 226). Die Gesetzmäßigkeit der Totalität beruhe „nicht mehr auf der variierten Wiederholung und der Wiederkehr des gleichen“ (W1 226). Totalität soll nicht mehr gelten als die Einordnung einer Vielheit, die gewisse einseitige Merkmale aufweist, „wir fassen darunter keine irgendwie quantitativ bestimmte Ordnung“, heißt es, und sie „ist nicht Einheit; denn diese bedeutet stets Wiederholung, und zwar Wiederholung ins quantitativ Unendliche“ (W1 226, 227).
So relevant die Bestimmungen der Totalität, wie sie sich aus der Kritik der Urteilskraft ableiten, in Hinblick auf die Formbestimmung totaler Gegenstände, aber auch in Hinblick auf die Organisation des Gedächtnisses auch sind, genauso wichtig ist die Bestimmung der Totalität als Qualität. Denn ausgehend von der Begrenzung der Realität durch Negation, die in der begrifflichen Erkenntnis notwendig und unproblematisch ist, gelangt Einstein zur Frage nach dem Agens der Verringerung der Empfindung, die er im Aufsatz Totalität offen lässt. Dort entscheidet er nicht, ob der „Unterschied der Qualität“ vom Gegenstand der Empfindung, also einem Realen abhängt oder, wie die andere Formulierung nahelegt, ob der „qualitative() Unterschied der Erlebnisse“ (W1 227) vom Subjekt mitbestimmt wird.
Einstein lässt diese Frage, die an Kants Strategie, sowohl der Empfindung als auch dem ihr korrespondierenden Objekt intensive Größe zuzusprechen, anknüpft, nicht zuletzt deswegen fallen, weil sie von Bedeutung für die Frage nach einer technischen, ästhetischen Bearbeitung der Form oder des „Stoffes“ ist, die er im Aufsatz Totalität unterdrückt. Er hat sie bewusst aus seinem Text herausgenommen, wie ein Blick auf die im Jahr 1910 begonnene Vorarbeit „der wille zur form”27 zeigt. Einstein streicht in dem publizierten Text nicht nur den dort verwendeten Begriff der Willkür, der ja auch an zentralen Stellen der Kritik der Urteilskraft auftaucht,28 sondern er zieht auch zurück, worauf die Totalität der Form in dieser Vorarbeit aus dem Jahr 1910 noch beruht:
in den menschlichen Dingen und unserm willen scheint ein trieb zu schaffen – der wille zur form. wenn ein künstler arbeitet ruht er nicht eher bis er gewisse forderungen – nämlich die der totalität seiner arbeit erfüllt hat. totalität stellen wir fest – wenn wir ein ding in einem einheitlichen zusammenschluß – in genau abgegrenzter und bestimmter weise erfassen – wenn es für sich ein ganzes bildet. totalität ist nicht irgend ein begriff sondern die zielstrebigkeit unseres willens. (…) ihre seelische bedingung ist einfachheit – reine genauigkeit des wollens und concentration. (W4 124)29
In dem vier Jahre später erscheinenden Text ist die offenbar durch Alois Riegl30 inspirierte Auszeichnung des Willens gelöscht. Einstein konzentriert sich auf das, was 1910 noch als „trieb“ im Willen schafft. Er geht die Probleme an, die er in der zweiten wichtigen Vorarbeit „Es ist eine Trennung zu schaffen“31 stichwortartig festhält und die auch deutlich zu erkennen gibt, dass dies in einer Auseinandersetzung mit Kant geschieht:
Problem der Lösung Erinnerung und Association –. Association hierzu die historische Bindung. … Nicht ausgehen von psychologischen Affekten – diese werden transportiert zu einer Totalität und münden in die Sachlichkeit des Kunstwerks. (…) Die „Logik“ des ästhetischen Urteils. Das Schließen des Zusammenhangs zwischen Erlebnis und Urteil. (…) die Sonderung der Wirklichkeiten durch ihre Versachlichung. Innen und Außenbeziehung. (…) Das unbewusste – das Infinitesimale des kausalen Denkens – das Verhältnis der Ursachen ihrer Quantität Qualität nach zum Verursachten. (W4 126f.)
Diese zwei wichtigen Vorarbeiten machen deutlich, dass Einstein bemüht ist, die Genese seines Konzeptes der Totalität zu verdecken. Und die Wirkung, die sein Text schon im Sinne des in ihm Entwickelten haben soll, hat ihn veranlasst, die für die ästhetische Produktion relevante Frage nach der gesetzmäßigen Willkür, mit der er verfaßt wurde, zurückzudrängen.
V.
Die Frage nach dem Agens der Empfindung ist schon in der Frage, was denn das „Subjekt macht, das eben Objekt und Subjekt konstatiert“ (Be 13), vorgebildet. Einstein geht ihr in einer Auseinandersetzung mit einigen Beispielen in der Kritik der reinen Vernunft und der Logik nach und ist dadurch offenbar zu dem angeregt worden, was man engführend seine „Poetik des Lichts“ nennen könnte, wie sie im Bebuquin realisiert ist.
Kant definiert, dass jede Empfindung und auch das ihr korrespondierende Objekt eine intensive Größe hat, wodurch sie die Zeit, „d.i. den innren Sinn in Ansehung derselben Vorstellung eines Gegenstandes, mehr oder weniger erfüllen kann, bis sie in Nichts (= 0 = negatio) aufhört.“ (KrV B 183) Unter dem „innren Sinn“ ist das Vorstellungsäquivalent des äußeren Sinns zu verstehen, dessen Form der Raum ist. Es stellt sich die Frage, wovon die Negation in der Empfindung abhängt. Wir haben es hier nicht mit einer aussagelogischen Negation zu tun. Die begriffliche Erkenntnis eines Objekts beruht auf einer Einschränkung (Limitation) der Realität durch Negation. Diese Limitation wird vom Subjekt vorgenommen. Im Kapitel „Vom Schematismus der reinen Verstandesbegriffe“ wendet Kant die Kategorie der Qualität auf die Zeit an, äußert sich dabei aber gezwungenermaßen nicht über die Limitation. Denn was sollte der Limitation, wie sie uns in der begrifflichen Erkenntnis begegnet, in Hinblick auf Empfindung entsprechen? Kant beruft sich darauf, dass
an den Erscheinungen etwas ist, was niemals a priori erkannt wird, und welches daher auch den eigentlichen Unterschied des Empirischen von dem Erkenntnis a priori ausmacht, nämlich die Empfindung (als Materie der Wahrnehmung), so folgt, dass diese es eigentlich sei, was gar nicht antizipiert werden kann. (KrV B 209)
Und von dem Realen der Empfindung sagt er, es sei eine „subjektive Vorstellung, von der man sich nur bewusst werden kann, dass das Subjekt affiziert sei“ (KrV B 207). Gleichwohl gibt Kant in verschiedenen Beispielen Hinweise, wovon es abhängt, dass die Empfindung bzw. das ihr korrespondierende Objekt in der Erscheinung in Nichts aufhört. Analog zu der Redeweise, die das Subjekt in der Apprehension die Zeit erzeugen ließ, spricht Kant in Hinblick auf die „Realität“ von einer
kontinuierliche(n) und gleichförmige(n) Erzeugung derselben in der Zeit, indem man von der Empfindung, die einen gewissen Grad hat, in der Zeit bis zum Verschwinden derselben hinabgeht, oder von der Negation zu der Größe derselben allmählich aufsteigt. (KrV B 183)
Kant veranschaulicht das mit verschiedenen Beispielen, in denen es ihm aber vorrangig um die Frage nach der Reihenfolge der Apprehension des Mannigfaltigen geht: „So ist z.E. die Apprehension des Mannigfaltigen in der Erscheinung eines Hauses, das vor mir steht, sukzessiv.“ (KrV B 253) In bezug auf dieses erste Beispiel verneint Kant die Frage, „ob das Mannigfaltige dieses Hauses selbst auch in sich sukzessiv sei“ (KrV B 253). Das zweite Beispiel lautet dann: „Ich sehe z.B. ein Schiff den Strom hinabtreiben“ (KrV B 236). Kant stellt dann fest:
In dem vorherigen Beispiele von einem Hause konnten meine Wahrnehmungen in der Apprehension von der Spitze derselben anfangen, und beim Boden endigen, aber auch von unten anfangen, und oben endigen, imgleichen rechts oder links das Mannigfaltige der empirischen Anschauung apprehendieren. (KrV B 237f.)
Im Schiff-Beispiel hingegen gilt:
es ist unmöglich, dass in der Apprehension dieser Erscheinung das Schiff zuerst unterhalb, nachher aber oberhalb des Stromes wahrgenommen werden sollte. Die Ordnung in der Folge der Wahrnehmungen in der Apprehension ist hier also bestimmt, und an dieselbe ist die letztere gebunden. (KrV B 237)
Daraus folgt für Kant:
Ich werde also, in unserm Fall, die subjektive Folge der Apprehension von der objektiven Folge der Erscheinungen ableiten müssen, weil jene sonst gänzlich unbestimmt ist, und keine Erscheinung von der andern unterscheidet. (KrV B 238)
Um dies zu verdeutlichen, nimmt Kant in dem Schiff-Beispiel die Idealisierung vor, den Blick des Subjekts dem Schiff folgen zu lassen, wie eine Kamera ihrem Helden. Im Haus-Beispiel zeigt sich, dass die objektive Folge der Erscheinungen vom Subjekt abhängt und keine Ordnung an sich hat. Es scheint, dass das Subjekt die objektive Folge der Erscheinungen bestimme, indem es seine Aufmerksamkeit auf Gegenstände richtet, und zwar in einer selbst gewählten Reihenfolge. Auch in Kants Logik begegnen wir dem Haus-Beispiel:
Sieht z.B. ein Wilder ein Haus in der Ferne, dessen Gebrauch er nicht kennt: so hat er zwar dasselbe Objekt wie ein Anderer, der es bestimmt als eine für den Menschen eingerichtete Wohnung kennt, in der Vorstellung vor sich. Aber der Form nach ist dieses Erkenntnis eines und desselben Objekts in beiden verschieden. Bei dem Einen ist es bloße Anschauung, bei dem Andern Anschauung und Begriff zugleich.32
Im Einstein-Nachlass findet sich eine Handschrift, die mit dem Satz beginnt, „ich sehe ein Haus“33. Schon dieser erste Satz weist auf einen sachlichen Zusammenhang zu dem Haus-Beispiel und dem Schiff-Beispiel hin, in dem es heißt: „Ich sehe z.B. ein Schiff“ (KrV B 236). Einstein beschäftigt sich in seinem Text wie Kant mit dem Zusammenhang Anschauung und Begriff, von Wahrnehmung und Gegenstandskonstituierung. Er illustriert das Verhältnis zwischen Sehen und Begriffsbildung analog zum Haus-Beispiel Kants:
ich sehe ein Haus, eine Strasse oder einen Baum, also ein Objekt. Wir sehen jedoch nur ein Teil des Objektes – wir erkennen es trotzdem, da wir es bereits kennen oder weil man uns mitgeteilt hat, was dies Objekt ist. Also wir sehen den Gegenstand u mechanisch löst das Sehen den Sinn, die Bedeutung des Gegenstandes aus. (W4 222)
Einstein stellt dann einen anderen Fall vor, in dem die mechanische Erkenntnis von Bedeutung, Kant würde sagen des Zweckes, nicht problemlos möglich ist, da, wie im Falle des Wilden, dem der Begriff eines bestimmten Objekts fehlt, die Vorstellung nur Anschauung ist. Er scheint sich dabei wieder auf Kant zu beziehen, der den Grundsatz feststellt, dass wir in der Lage sind „Wahrnehmungen zu antizipieren“ (KrV B 213) und deren Mangel zu ergänzen:
wir sehen von fern einen Gegenstand. der eine sagt, dies ist eine Hütte, der andere … das ist ein Busch. d.h. jeder sieht den gleichen Ausschnitt, aber das Sehen jedes Einzelnen löst eine verschiedene Sinngebung aus. (…) auf der Retina ihrer Augen wird der gleiche Gegenstand reflektiert u. sie deuten ihn verschieden (W4 222).
Einstein gibt hier an, wo eine „Spiegelung“ der Außenwelt gedacht werden kann, ohne dass sie dem Menschen zugänglich wäre, nämlich auf der Retina. Das „Bild spiegelt sich in der Retina. dies wäre sozusagen die erste primäre optische Beziehung“ (W4 227). In einem anderen Beispiel wird deutlich, in welchem Verhältnis das Licht zum Sehen steht und wovon es abhängt, was in unsere Wahrnehmung gelangt. Ein Zeichenlehrer mit seiner Familie und ein Maler versuchen, ein Haus in einem Bild festzuhalten. Der Maler klärt den Lehrer darüber auf, warum seine architektonische Zeichnung nichts taugt: „dieser Schatten ist sinnlos (…) er ist jetzt nicht mehr da, das Licht hat gewechselt“ (W4 224). Die Affizierung des Subjekts durch Gegenstände ist vor allem eine durch Licht. Bei Kant heißt es:
Die Farben sind nicht Beschaffenheiten der Körper, deren Anschauung sie anhängen, sondern auch nur Modifikationen des Sinnes des Gesichts, welches vom Lichte auf gewisse Weise affiziert wird. (KrV B 44/A 28-B 45/A 29)
Eine Rose könne in „jedem Auge in Ansehung der Farbe anders erscheinen“ (KrV B 45). Dem Zeichenlehrer fehlt diese Erkenntnis. Er hält seinem Kind vor, die falschen Farben zu verwenden, womit er sich den Spott des Malers zuzieht. Von der Rolle des Lichts verrät Kant aber noch mehr: „das Licht, welches zwischen unserm Auge und den Weltkörpern spielt, (kann) eine mittelbare Gemeinschaft zwischen uns und diesen bewirken“ (KrV B 260). Einstein ist in seiner Auseinandersetzung mit dem Kapitel „Antizipationen der Wahrnehmung“ zwangsläufig auf diese Rolle des Lichts gestoßen. Denn dort handeln die Beispiele, die Kant bemüht, um zu illustrieren, dass „die intensive Größe in verschiedenen Erscheinungen kleiner oder größer sein … (kann), obschon die extensive Größe der Anschauung gleich ist“ (KrV B 214), von Licht:
In dem innern Sinn nämlich kann das empirische Bewusstsein von 0 bis zu jedem größeren Grade erhöhet werden, so dass eben dieselbe extensive Größe der Anschauung (z.B. erleuchtete Fläche) so große Empfindung erregt, als ein Aggregat von vielen andern (minder erleuchteten) zusammen. (KrV B 217)
Einstein wird bemerkt haben, wie nahe Kant mit diesem Beispiel an das Problem des Wahrnehmens herangekommen ist. Denn gerade die Empfindung der intensiven Größe „Licht“ geschieht in mehrfacher Hinsicht in einem Augenblick. Ich hatte darauf hingewiesen, dass es problematisch ist, dass Kant sowohl der Empfindung als auch dem ihr korrespondierenden Objekt, dem Realen, eine intensive Größe beilegt. Er nennt die Schwere als Beispiel einer augenblicklichen Apprehension einer intensiven Größe der Realität. Mit dem Begriff „Augenblick“ ist hier nur ein bestimmter Zeitpunkt gemeint. Die intensive Größe dieser in der augenblicklichen Apprehension erzeugten Realität der Schwere entscheidet sich nicht durch das Subjekt, obwohl verschiedene Subjekte sie verschieden empfinden mögen. Die „Erzeugung“ der Realität „Licht“ geschieht gleichfalls in einem „Augenblick”. Aber es ist ein „Blick der Augen“, der über die intensive Größe der Empfindung dieser Realität entscheidet und auch darüber entscheidet, was uns affiziert. Genauer: das Subjekt schwankt zwischen einer Affizierung durch Licht und einer bewusst gerichteten Aufmerksamkeit, der ein fokussierender Blick entspricht. Es bedarf nur eines Blinzelns des Subjekts, um die intensive Größe der Realität in der Empfindung zu verringern. Es ist ein Blick der Augen des Subjekts, mit dem sich die intensive Größe der Realität der Empfindung (hier: Helligkeit), aber auch der Empfindung der Realität in der Wahrnehmung ändert.
Hat Einstein nun die schon bei Kant nachvollziehbare Bedeutung des Lichts deshalb so betont, weil ihm bewusst war, dass das Auge in seinem Verhältnis zum Licht eine ausgezeichnete Metapher für menschliches Wahrnehmen und Erkennen ist? Im Aufsatz Totalität stellt er die zentrale Rolle des Gedächtnisses und des Psychischen heraus. Aber schon sein 1907 begonnenes Erstlingswerks Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders weist dem Licht eine seiner Bedeutung entsprechende Stellung an.
VI.
Im Bebuquin ist die Rolle des Lichts derart ausgeprägt, da§ es gerechtfertigt erscheint, von einer Poetik des Lichts zu sprechen. Licht dominiert schon die einleitenden Sätze der Erzählung:
Die Scherben eines gläsernen, gelben Lampions klirrten auf die Stimme eines Frauenzimmers: „Wollen sie den Geist Ihrer Mutter sehen?“ Das haltlose Licht tropfte auf die zartmarkierte Glatze eines jungen Mannes, der ängstlich abbog, um allen Überlegungen über die Zusammensetzung seiner Person vorzubeugen. Er wandte sich ab von der Bude der verzerrenden Spiegel, die mehr zu Betrachtungen anregen als die Worte von fünfzehn Professoren. Er wandte sich ab vom Cirkus zur aufgehobenen Schwerkraft, wiewohl er lächelnd einsah, dass er damit die Lösung seines Lebens versäumte. (Be 3)
Der Erzähler führt die Figur Bebuquin mit sich wiederholenden Bewegungen der Abwendung ein. Bebuquin erscheint damit als Der Snobb, von dem Einstein im gleichnamigen Essay34 sagt, ihm sei „die Angst, auf Sich zu geraten“ (W1 25), eingegraben. Er suche „die Verneinung … als intensivste Wahl, als Bejahung einer höchstvereinzelten Seltenheit“ (W1 24). Aber dieser Romanbeginn hat auch eine ausgezeichnete poetologische Bedeutung. Der Erzähler hebt das Licht hervor, indem er es als ein verkörpertes erscheinen lässt. Das Licht, aber auch Töne führen uns durch Passagen, in denen die Prozessualität des Wahrnehmens in ihrem konstitutiven Verhältnis zu einer Empfindung des Verfliessens von Zeit zu einer Darstellung gebracht wird, die sie zugleich evozieren soll.
Es hatte sich gezeigt, dass für Einstein die Empfindung eines Verfließens von Zeit durch das Erlebnis qualitativer Unterschiede entsteht, ohne dass dabei als Bedingung eine a priorische, quantitive Zeitvorstellung vorausgesetzt wäre. Im Gegenteil, diese Erlebnisse ermöglichen erst die retrospektive Vorstellung eines quantitativen Zeitraums, in der die qualitative Bestimmung aller „Zeitpunkte“ verloren geht. Die ersten beiden Sätze des Romans operieren mit „artifiziellen“ qualitativen Differenzen. Wir begegnen einem gelben Lampion, der aus Glas, nicht aus Papier besteht, dessen erzähltes Licht nicht etwa im konventionellen Sinn fällt und erhellt, sondern als „Scherben“ auf die Stimme eines Frauenzimmers „klirrt“ und im nächsten Moment auf die Glatze Bebuquins „tropft”. Im ersten Satz wird eine kontinuierliche Zeitfolge aufgehoben: das Licht des gelben Lampions figuriert schon als „Scherben“, ist zu diesen schon zersprungen, bevor es „klirrt“, bevor es auf eine „Stimme“ „fällt“, die dadurch als eine hysterische erscheint, wie eine, deren Frequenz ein Glas zerspringen lassen könnte. Im zweiten Satz begegnen wir einer Zeitdehnung. Dort „tropft“ das Licht, wodurch die „Strahlen“ des Lichts gleichsam „gestaucht“ erscheinen.
In den beschreibenden Passagen des Bebuquin verwendet Einstein Ausdrücke, die vom Sehen her gebildet sind, das jederzeit von Licht dominiert wird. Die erste Einführung des Cafés, das ein zentraler Schauplatz des Romans ist, wird durch eine Wort- und Satzzusammenstellung geleistet, in der das Licht auf subtile Weise ein dynamisches Wahrnehmen des Raums leitet:
Um die Tische verbanden sich die Wiener Rohrstühle zu rhythmischen Guirlanden. Die Nase eines Trinkers konzentrierte die Kette jäh. Die Lichter hingen klumpenweise von der Decke und zerplatzten die Wände zu Fetzen. (Be 13)
Die „Guirlanden“ sind hier weniger eine implizite Metapher für die „Wiener Rohrstühle“, sondern eher das, was Einstein mit seinem gewollt unscharfen Begriff der „Parafrase“35 in dem gleichnamigen Essay aus dem Jahr 1913 bezeichnet: „Parafrase unterdrückt eine deutliche Vorstellung, und sie ist grenzenlos, zumal sie jenem Dinge zumutet von geradezu vernichtender Allegorik.“ (W1 167) Und dort heißt es: „Parafrase ist, eine handfeste Sache zu entphilosophieren und als Vorwand zu einem Einfall zu benutzen.“ (W1 168) Die „Parafrasierung“ der „Wiener Rohrstühle“ mittels „Papierketten“ wird durch die konterkarikierende „jähe“ Konzentration in der „Nase eines Trinkers“ parodiert. Scheinbar wird die von der „Nase eines Trinkers“ jäh konzentrierte (Papier-)Kette als eine unzulässige Assoziations-Kette entwertet. Aber die „Kette“ des zweiten Satzes, die sowohl Papierkette als auch eine Assoziations-Kette sein kann, geht mit den Lichtern des dritten Satzes eine Verbindung ein. Die Kette der Assoziationen der ersten beiden Sätze erweitert sich durch das Licht des dritten Satzes, das auf sie zurückfällt. Es versetzt sie in eine Schwebe, die wir nicht durch Entscheidung aufheben können. Die „Guirlanden“ des ersten Satzes verbinden sich konnotativ mit Lampions, Lichterketten. Der Erzähler lässt uns durch die implizite Metapher des ersten Satzes einer Assoziation folgen, die sich im Zusammenspiel des zweiten und dritten Satzes als eine unzulässige, „parafrasierende“ Assoziations-Kette erweist, die durch das „ausgelöst“ wird, was in einem konzentrierten, durch Licht geleiteten Blick in die Wahrnehmung gelangt. Diese Assoziations-Kette, aber auch der konzentrierte Blick zerstreuen sich im dritten Satz durch einen zu starken Lichteinfall, der wiederum nur „parafrasierend“ beschrieben werden kann, nämlich als Licht, das die Wände zerfetzt. Die Bewegung des Lichts vollzieht sich wie die einer Feuerwerksrakete, die zielstrebig in den Himmel steigt und dann zerplatzt.
Die Bedeutung des Wortes „Kette“ wird durch den Bezug auf andere Stellen des Romans vieldeutig.36 Bebuquin sagt: „ich kann nicht in der Kette weiterleben, ich will nicht, es wäre moralisch inkonsequent. Man treibe mich nicht in die alten Gleise und sei barmherzig.“ (Be 34) In der Einführung des Cafés ist ein Bezug zu der Kette einer Assoziation gegeben, zu einer „Kette des Zusammenhangs …, die wir Gedächtnis nennen und die unser Ich ausmacht“ (W1 13), wie es in der ersten Legende der im gleichen Zeitraum entstandenen Erzählungen „Verwandlungen“37 heißt. Der fokussierende Blick, dem wir bis zur Nase des Trinkers folgen, wird durch eine „parafrasierende“ Assoziationsreihe dargestellt, die auf einer Gedächtnisleistung basiert. Eine Assoziationskette, die durch Licht ausgelöst ist und die abrupt zerreißt durch ein Licht, das die Wände zerplatzt. So wandelt sich die Assoziations- zur Dissoziationskette, die – das ist intendiert – auch den Leser erfassen soll.
In der Café-Szene ist es gleichfalls ein sich konzentrierendes und dann versprühendes Licht, das der Figur Euphemia zu ihrem Auftritt verhilft:
Euphemia trat in das Café ein. Das gelbe Licht gab ihren Röcken, – die sich wie Wogen von Rudern bewegten, über ihre straffen Beine schäumten, – Konturen, die in ihrem Hut zusammenliefen und an dem weit überhängenden Federbouquet ihres Hutes versprühten. (Be 14)
Hier ist es wieder das Licht, das – „gebremst“ durch den „parafrasierenden“ Vergleich in den Gedankenstrichen – Konturen verleiht, die durch ihr Versprühen die Erscheinung noch verstärken. Der Vergleich ist für Einstein eine „Parafrase“, wie das zweite Beispiel des gleichnamigen Essays zeigt. Parafrase ist, wenn einer sagt,
dass die zwielichte Seele von Fräulein Ludmilla Meierson wie eine Flagge auf Halbmast in das raschelnde Rostrot des verblutenden Herbstes gesenkt ist, wobei er eine gute oder schlechte Handlung der Dame berichten will. (W1 167)
Wir finden auch Stellen, in denen die erzählkonstitutive Funktion des Lichts betont wird und dieses nicht der Bewegung einer Konzentration, die in ein Zerplatzen umschlägt, folgt:
Der Schein der elektrischen Lampen fuhr ihr (Euphemia, D.D.P.) durch die Spitzen zum Knie, tanzte über die Kristallflacons und die Sektkühler erregt rückwarts; das sonst anständige elektrische Licht! (Be 16)
Die phantastische Autonomie des Lichts wird in diesem Beispiel ironisch hervorgehoben. Das künstliche Licht der Gaslampen, elektrischen Lampen, Bogenlampen, Scheinwerfer, Reklametransparente, das sich im Bebuquin von Anfang als das erweist, was die Gegenstände in der Erscheinung gibt, zeichnet sich scharf von der alle Szenen beherrschenden Nacht ab, die erst die intensive Wirkung und die Betonung der Funktion des Lichts ermöglicht. Die Nacht wird von den Dilettanten bevorzugt, da sie die jederzeit verpflichtende „empirische“ Welt des Tages verdunkelt, die sie genau wie die „Wände“ und den eigenen Körper als Begrenzung empfinden:
Sie waren ihres Körpers und seiner Formen unabweislich müde geworden und spürten, dass sie sich verzerren müßten. Unter der blöden Sonne gingen die Grauen heim. Die Landschaft war wie auf ein Brett gestrichen, die aufgerissenen Augen spürten nicht mehr vor Überreizung, dass es heller und klarer wurde. Das Licht der Glühlampen und die sie umhüllende Finsternis steckte noch in den Sehnerven. Bebuquin suchte weinend der Sonne in einen imaginären Bauch zu treten. (Be 21f.)
In der Nacht wähnen sie einen Freiraum für ihre Phantasie, mit der sie eine eigene Welt schaffen wollen, wie es Bebuquin exemplarisch für alle Dilettanten des Wunders herausschreit: „Ich will nicht eine Kopie, keine Beeinflussung, ich will mich, aus meiner Seele muss etwas ganz Eigenes kommen, und wenn es nur Löcher in eine private Luft sind.“ (Be 4) Bebuquin tritt der Sonne ohnmächtig in einen imaginären Bauch, weil sie ein übermächtiges Licht produziert, dessen Funktion erst durch das künstliche Licht in der Nacht klar hervortritt. Diese erzähltechnisch propagierte und ins Phantastische gesteigerte Funktion des Lichts wird von den Dilettanten gemieden, ist ihnen aber dort, wo sie einen Erzählerkommentar abgeben oder sich poetologisch äußern, in widersprüchlicher Weise zugleich bewusst. Im vierten Kapitel, unmittelbar vor der schon diskutierten Cafe-Szene, ist es Nebukadnezar Böhm, der Bebuquin gegenüber eine „Poetik des Lichts“ postuliert, und zwar eingebettet in die schon ausführlich diskutierte Polemik gegen Kant:
Bebuquin, sehen sie einmal. Vor allen Dingen wissen die Leute nichts über die Beschaffenheit des Leibes. Erinnern sie sich der weiten Strahlenmäntel der Heiligen auf den alten Bildern und nehmen Sie diese bitte wörtlich. Denken Sie eine Frau unter der Laterne; eine Nase, ein Lichtbauch, sonst nichts. Das Licht, aufgefangen von Häusern und Menschen. Damit wäre noch etwas zu sagen. Hüten Sie sich vor quantitativen Experimenten. (Be 12)
Das „sehen sie einmal“ ist nicht nur eine Aufforderung an Bebuquin, aufmerksam zu sein, sondern zugleich „wörtlich“ zu nehmen wie die „Strahlenmäntel der Heiligen auf den alten Bildern”. Böhm gibt deren Funktion zu erkennen, nämlich die Heiligen in die Wahrnehmung zu bringen. Und die Nase, von der Böhm spricht, begegnet uns wenige Zeilen später als „die Nase eines Trinkers“ (Be 13) wieder, in der lichtdominierten Einführung des Cafés.
Der Erzähler legt den Figuren des Bebuquin Einsichten in den Mund, die ihr verzweifeltes Suchen nach einem absoluten Wunder, das frei von allen empirischen Begrenzungen entstehen soll, übersteigen. Das zeigt sich auch in der Szene, in der der Platoniker Ehmke Laurenz eine Abfuhr erhält:
Herein kam eine Dame, hintendrein ein dünner, ziemlich durchsichtiger Herr. Er stellte sich in die Ecke und litaneite. „Ehmke Laurenz, Platoniker, gehe nur nachts aus, weil es da keine Farben gibt. Ich suche die reine ruhende Idee, diese Dame tatkräftig rhythmische Erregung. Ich bin eigentümlich, da ich von zwei Dingen ruiniert werde, einem höheren der Idee und einem niederen der Dame.“ „Ja aber ruinieren Sie doch die beiden, die sich bedingen, zum mindesten Ihre blödsinnige Ideologie vom Sein, von der Langeweile, dem Tod. Das ist nur Müdigkeit, ein Defekt, Platonismus ist Anästhesie. Reißen Sie sich doch Ihre Augen aus und die Ohren, dann haben Sie Ihren Platonismus zu Wege gebracht.“ (Be 26)
Wir können nicht entscheiden, ob der Vorschlag, Augen und Ohren auszureißen, der Figur Heinrich Lippenknabe oder Bebuquin zuzuordnen ist. Aber die Kritik trifft hier nicht einfach nur den Typus des Dilettanten, der das Wunder durch das Übersteigen der empirischen Welt in einer rückerinnernden Anamnesis erreichen möchte. Sie trifft auch eine Abstraktion, die alle Dilettanten des Romans permanent vollziehen. So ist das Ausreißen der Augen und Ohren Konsequenz eines Platonismus, aber zugleich auch Konsequenz der angestrebten ursprünglichen Anschauung, die nicht Erinnerung ist, sondern „durch die selbst das Dasein des Objekts der Anschauung gegeben wird (und die, so viel wir einsehen, nur dem Urwesen zu kommen kann)“ (KrV B 72), wie Kant es formuliert, der Gott entsprechend mit der Freiheit von beschränkter Sinnlichkeit und Denken ausstattet, womit dieser zugleich stärkstes Argument gegen eine mythische Konzeption des Genies ist, das ja aus dem Nichts schöpfen können soll. Im Bebuquin ist Heinrich Lippenknabe dann ja auch explizit als Parodie des romantischen Genies angelegt. Aber von den „Dilettanten des Wunders“ erkennen einige immerhin ihre dem Göttlichem unterlegene Existenzweise. So etwa Bebuquin mit der verzweifelten „Frage-Einsicht”38: „Ich bin ein Spiegel, eine unbewegte, von Gaslaternen glitzernde Pfütze, die spiegelt. Aber hat sich je ein Spiegel gespiegelt?“ (Be 4) diese rhetorische Frage lässt sich als weitere Absage an die Romantik begreifen,39 legt uns aber vor allem nahe, dass die Spiegelmetapher eine blinde ist. Sie gibt nicht wieder, was menschliches Wahrnehmen und Erkennen ausmacht. Der Spiegel ist nur das passive, „blinde Auge“, das „nur durch die Güte der Dinge lebt“ (W1 25f.), wie es in Der Snobb heißt. Spiegelt sich ein Spiegel in einem Spiegel, so sind beide leer, allein ihre Funktion zu spiegeln tritt hervor. Der Spiegel könnte nur als Metapher der Retina verstanden werden, auf der sich „passiv“ ein Bild der Außenwelt „spiegelt”. Sie gibt nur „die erste primäre optische Beziehung“ wieder; das „Bild spiegelt sich in der Retina“ (W4 227). Aber die rhetorische Frage bleibt nicht einfach in der epistemologischen Blindheit der Spiegelmetapher40 befangen. Die eingeschobene Konkretion, „Ich bin ein Spiegel, eine unbewegte, von Gaslaternen glitzernde Pfütze“, übersteigt sie. Wir begegnen hier der Gaslaterne als Spender desjenigen, was im Roman in seiner Funktion hervorgehoben wird zu bestimmen, was in die visuelle Wahrnehmung gelangen kann: Licht. In dem Essay Parafrase sagt uns Einstein, wie er die „Parafrasen“, die er im Bebuquin verwendet, verstanden haben möchte:
Es fordert Takt, Genauigkeit und Gleichgewicht, zu schildern wie ein Mensch unter einer Gaslaterne steht, ohne der Laterne zu entdichten, was ihr als Laterne der städtischen Gasanstalt zu eigen und ohne den Menschen zu verleuchten, dass er nur ein eitel Spiel Licht und Dunkel flirrt; jedoch so zu dichten, dass beide entschieden Laterne und Meier sind. Sicher zeugt es nicht von Klarheit und Bezeichnung, Meiern die Gaslaterne überstrahlen zu lassen dank seiner inneren abgeklärten Reinheit, und somit die Laterne als Vorwand zum Verdunkeln zu verwenden. (W1 169)41
Einstein reflektiert hier selbstkritisch sowohl den Kunstgriff, alle Szenen des Bebuquin in der Nacht spielen zu lassen, damit das Licht dominieren und in seiner Funktion, die Figuren und alle Orte zu „erstrahlen“, hervortreten kann, als auch die kontrastive Wirkung, die die stets auch „parafrasierenden“, lichtdominierten Passagen gegenüber den langen Monologen und Dialogen haben.
Das im Bebuquin phantastisch bis zur Subjektqualität gesteigerte Licht ist maßgeblich dafür verantwortlich, was an Objekten in die Erscheinung gelangen kann. Aber der Einsatz des Lichts im Bebuquin zielt primär auf den Leser. In der phantastischen Steigerung zeigt sich die Funktion des Lichts, die die Figuren des Romans nicht wirklich betrifft. In den lichtdominierten Szenen sind sie lediglich Staffage und erleben an der Autonomie des Lichts nicht ihr ersehntes Wunder. Gleichwohl ist die „erzählte“, durch Licht geleitete, ins Unbeherrschte und Grenzenlose gehende Wahrnehmung an die Figuren gekoppelt. Teils erleiden sie, teils üben sie in einem „ernsten Training“ (Be 21) ein, was auf der Erzählebene durch Licht ausgelöst wird, ein Sichverlieren, eine Dissoziation des bewussten Ichs, die auf den Leser überspringen soll.
Die von Einstein realisierte Poetik des Lichts zeigt, dass er in gewisser Weise den epistemologischen Rahmen Kants nicht verlässt. Die programmatisch und erzähltechnisch hervorgehobene Funktion des Lichts lässt sich als eine Konkretion des Gegebenseins der Gegenstände in der Wahrnehmung begreifen. Wir begegnen keiner Nachahmung einer als empirisch vorausgesetzten Welt. Deren Existenz wird keineswegs geleugnet, nur ist sie als „Ding an sich“ unerkennbar. Für Einstein gilt, dass ein platonisches „Urbild“, eine Idee nie existiert hat. Wir haben es von vornherein nur mit Schein zu tun, der aber nicht „bloßer Schein“ ist, sondern stets in Relation zu einem „Objekt an sich“ steht, wie Kant es formuliert. Kein Wesen sieht die „Dinge an sich“, sondern nur so, wie sie entsprechend der Lichtempfindlichkeit und der Fähigkeit der Raum- und Farbwahrnehmung erscheinen. Entsprechend ist Einstein im Bebuquin um eine Nachahmung des menschlichen Wahrnehmens bemüht, in der dessen Dynamik erhalten bleibt. Das zeugt zugleich von einer Absage an das unbedingte Wunder, nach dem die Dilettanten vergeblich suchen, obwohl es sie permanent umgibt. Sie erleben es weder am phantastischen Licht, noch am verstorbenen, imaginativ existierenden Böhm, ebensowenig an dem von Euphemia „jungfräulich“ (Be 14) geborenen Emil, der schon als Embryo über „die zerstörte Nabelschnur oder das principium individuationis“ (Be 17) doktorierte und dem eine lichtempfindliche Haut zu eigen ist, die fortwährend die Farbe wechselt.
In den „Unterlagen und Notizen zu Pariser Vorlesungen”42 bezeichnet Einstein den Menschen nach dem Tod Gottes als den „ungestützte(n) Ursprung, die Vereinsamung des Menschen ohne Gott, Verlassenheit abandon bis zur Annexion der Rechte des Schöpfers“ (W4 168), an der die Dilettanten des Wunders gründlich scheitern. Genauso wie der Roman können sie nicht eine Freiheit erreichen, die menschliche Sinnlichkeit und Denken überwindet. Der Roman jedoch erstrebt eine Freiheit von der „entkonkretisierenden“ Macht des logischen Denkens, die er dem Leser schenken will.
Einstein trifft im Bebuquin mehrere Maßnahmen, den stabilisierenden Effekt, den die Sprache gegenüber den sich stets modifizierenden Empfindungen und Wahrnehmungen hat, zurückzudrängen und das sich unausweichlich linear entfaltende Erzählen so zu verfassen, dass ein Verstehen sich erst durch ein Durchbrechen der Linearität des Lesens herstellt. Diese Funktion erfüllen zunächst die vielfältigen strategischen Metaphern, die darauf abzielen, so auf alle anderen Stellen des Romans hinzulenken, wie das Licht zu allen Seiten hin strahlt, aber dann auch die zwischen „parafrasierender“ Assoziation und lichtdominierten Sehen schwankenden, „erzählten“ Wahrnehmungen und Erlebnisse und die sich davon scharf abzeichnenden monologischen und dialogischen Reflexionen.
Mit dem Bebuquin legt Einstein ein Werk vor, das in Teilen schon als Umsetzung seiner erst im Aufsatz Totalität ausgearbeiteten ästhetischen Theorie gelten kann. Dort entwickelt er vor allem in Auseinandersetzung mit Kant anders als dieser nicht eine Genese des ästhetischen Gemeinsinns, sondern eine Genese, wie sie in der dritten Kritik nur latent angelegt ist, nämlich eine Genese der menschlichen Vermögen.43 Während Kant noch eine innere Natur vor allem im Zusammenhang des Geniebegriffs erörtert, baut Einstein aus scheinbar disparaten Theoremen Kants seine Theorie des Psychischen, die unter dem Titel Totalität die Natur des Menschen überhaupt, und nicht nur eine innere des Genies in den Blick nimmt.44 Totalität meint dabei auch das Vermögen der Formen, das uns bei Kant als Vermögen ästhetischer Ideen begegnet:
Man kann … Genie auch durch das Vermögen ästhetischer Ideen erklären: wodurch zugleich der Grund angezeigt wird, warum in Produkten des Genies die Natur (des Subjekts), nicht ein überlegter Zweck, der Kunst (der Hervorbringung des Schönen) die Regel gibt. (KU § 57, Anmerkung I, 242)
Nur das, „was bloß Natur im Subjekte ist“ könne „zum subjektiven Richtmaße“ der „ästhetischen aber unbedingten Zweckmäßigkeit in der schönen Kunst“ (KU § 57, Anmerkung I, 242) dienen. Einstein sieht hier die Möglichkeit, das, was Kant die Natur im Subjekt nennt, positiv zu bestimmen. Und zwar gegen Kant, doch mit dessen eigenem Begriff organisierter Wesen, deren Bestimmungen Einstein der Natur des Menschen unterlegt. Für Kant hingegen gilt in § 65 der Kritik der Urteilskraft, dass die Heautonomie organisierter Wesen nicht analog in der Kunst angetroffen werden könne, denn in ihr „denkt man sich den Künstler (ein vernünftiges Wesen) außer ihr“ (KU 239), womit er das unterschlägt, was er dem Genie zuvor exklusiv zugebilligt hat und worauf sich Einstein prompt beruft, nämlich die „Natur im Subjekte”. Indem Einstein nun das vernunftbegabte Wesen Mensch zugleich und genau wie auch das Kunstwerk als ein organisiertes Wesen im Sinne Kants betrachtet, entkräftet er einerseits dessen Einwand, in der Kunst denke man sich den Künstler als äußerliche Ursache, die ein Verstand oder eine Vernunft vorgegeben hat. Andererseits überträgt er damit Kants intellektuelles Interesse an der Fähigkeit der äußeren Natur, aus der Materie lustvoll reflektierbare Formen zu erzeugen,45 auf den Menschen als Naturwesen. Einstein konkretisiert dabei das, was bei Kant noch „Vermögen ästhetischer Ideen“ heißt und von einer Logik des Begriffs denkbar weit entfernt ist, mit Hilfe der Bestimmungen des Begriffs organisierter Wesen und will so nicht weniger als die formale, struktuelle und dynamische Organisation des Psychischen umschreiben, die aller Wahrnehmung, ästhetischer wie logischer Reflexion, aber auch der Produktion und Rezeption von Kunst zu Grunde liegt. Aber wie lässt sich diese Auflösung des Geniebegriffs in Hinblick auf Kants Konzeption des ästhetischen und logischen Urteils und die darin implizit fortgeführte Theorie der Vermögen rechtfertigen? Und was wird aus der kritischen Funktion wenn nicht des Genies so des Künstlers, wenn die ihm ehemals exklusiv zugestandenen Eigenschaften in eine allgemeine Psychologie des Menschen übergehen?
VII.
Kants Theorie des ästhetischen Urteils und die der darin verwickelten Vermögen ist alles andere als einfach. In Bezug auf das Genie lässt sich immerhin soviel sagen, dass es sich vom Normalsterblichen weniger durch das Verhältnis unterscheidet, das die Vermögen im logischen oder ästhetischen Urteil zueinander einnehmen, sondern mehr durch das Talent, vor allem die innersubjektive Aktivität der Vermögen, wie sie sich bei jedem in der ästhetischen Reflexion zeigt, zu veräußerlichen, d.h. sie in den Dienst der Produktion von Kunstschönem zu stellen.
Im Vergleich zum logischen, begrifflichen Urteil würde das ästhetische Reflexionsurteil über das Naturschöne wie Unsinn erscheinen, wenn mit ihm nicht nur die Schönheit des Gegenstandes in der Erscheinung prädiziert, sondern auch dem freien, harmonischen Spiel von Einbildungskraft und Verstand, so wie es für die ästhetische Reflexion charakteristisch ist, Ausdruck verliehen werden soll. Herauskommen würde „Unsinn“ durchaus auch im Sinne unsinniger Wörter und Sätze, da die Einbildungskraft als Vermögen bildlicher, anschaulicher Darstellungen stets auch auf den Verstand als Vermögen der Begriffe bezogen ist, und zwar auf unbestimmte und unbestimmbare Begriffe.
Das Genie ist nun bei Kant das Talent, „dasjenige, wozu sich keine bestimmte Regel geben lässt, hervorzubringen”. Und „Originalität (müsse) seine erste Eigenschaft sein“ (KU 182). Regelloses, wie es im freien Spiel der Vermögen in der ästhetischen Reflexion auf das Naturschöne erscheint, ist Unsinn. Das Genie indes produziert „originalen Unsinn“, was Kant keineswegs genügt, denn auch originaler Unsinn bleibt Unsinn. Deswegen müssen sich die original unsinnigen Produkte des Genies zugleich als „Muster“ (KU 182) und Beispiel einer bis dahin noch nicht existierenden Regel durchsetzen, und zwar im dialektischen Wechselspiel mit dem Geschmack der Zeit.46 Das Genie kann nicht vollständig wissen, „wie es sein Produkt zu Stande“ (KU 182) bringt, weil die ästhetische Einbildungskraft im Zusammenspiel mit dem Verstand, der Vernunft und der Urteilskraft nicht ausschließlich den Gesetzen der begrifflichen Erkenntnis folgt. (Deswegen legt Einstein hier eine Struktur zugrunde, die er dem schon bei Kant paradoxen Begriff organisierter Wesen entnimmt.) Damit aber überhaupt aus originalem Unsinn Sinn und Regel werden kann, muss im Kunstschönen, anders als im Naturschönen, auch ein Bezug auf bestimmte Verstandes- oder Vernunftbegriffe bestehen, allerdings ohne dass einer beigesellten ästhetischen Idee „irgend ein bestimmter Gedanke, d. i. Begriff adäquat sein kann“ (KU 194). Jedoch nicht nur eine geniale, sondern die ästhetische Einbildungs- und Urteilskraft insgesamt muss sich an der Tradition abarbeiten und bleibt selbst beim Versuch, diese völlig zu negieren, negativ auf sie bezogen. Das zeigt sich auch bei Einstein. Schon mit den im Bebuquin bezogenen Positionen und erst recht angesichts seiner elaborierten ästhetischen Theorie bleibt kein Zweifel daran, dass er sich gegen die romantische Vorstellung eines mythischen Genies wendet, das aus dem Nichts schöpft. Die Vorstellung einer „creatio ex nihilo“ ist stets mit der eines metaphysisch aufgeladenen „Nichts“ verbunden. Gerade die von Kant formulierte Idee eines Gottes, der über die Fähigkeit ursprünglicher Anschauung und Schöpfung verfügt, ist im Bebuquin zugleich Maßstab und beste Sicherung gegen die romantische Konzeption eines gottähnlichen ästhetischen Subjekts.
Eine Kritik des mythischen Geniebegriffes, die als dessen Grundlage eine Definition des Schönen als begriffslos annimmt,47 muss vernachlässigen, dass die ästhetische Reflexion bei Kant nicht begriffslos, sondern ohne bestimmten, d.h. logischen Begriff ist. Würde sich die ästhetische Reflexion (un-) mittelbar durch Worte äußern, wären diese der „Unsinn“, von dem Kant in Bezug auf den Sonderfall des Genies als einem „originalen Unsinn“ spricht. Doch die Dialektik von Unsinn und Sinn ist alles andere als einfach, wie wir unschwer an Kants angestrengtem Versuch, klare Grenzen zu ziehen, erkennen können.48 Nicht zuletzt durch den Prozess der Avantgarde scheint jedes Maß für Regeln und Regelverletzungen verloren gegangen zu sein. Die Traditionskritik des Genies wendet sich jedoch nur dann gegen es selbst, wenn es zu einer Beschleunigung der Innovationszyklen, einem Allgemeinwerden des ehemals Genialem kommt. Wenn die avantgardistische Revolution ihre Kinder frisst, dann als Einverleibung. Einstein hat sich darauf mit seiner ästhetischen Theorie, die sich in genau diesem Sinne die Kategorie des Genies einverleibt, aber auch schon mit seinem Bebuquin eingestellt. Der Nachlasstext „Diese Aesthetiker veranlassen uns“ sagt uns, was man sich von einer Kunst versprechen darf, die als einzige Regel nur noch die setzen kann, alle zu brechen, und deswegen auch nicht mehr auf eine Bestätigung durch den Geschmack der Zeit spekuliert:
die Wiederkehr und Vermehrung des Chaotischen. Vermittels des Gestaltzuwachses steigert man die Disparatheit gegen alle logische Vereinheitlichung und jede Form bedeutet uns nur ein vorläufiges Deplacement des Chaotischen. Gerade in der Zerstörung der Kontinuität, der Entsinnung der Welt, liegt die Chance unserer Freiheit. (W4 219f.)
Gleichwohl und gerade so soll die Kunst zu dem werden, was nach Einstein einst Gott war, zum „centre des paradoxes et des rêves“ (W4 178).49 Sie könne aber nicht wie Gott zugleich „Summe und Einheit alles Wirklichen“ sein. Mit dem Tod Gottes sei die „dialektische Mitte“ (W4 210) verschwunden und ein „dialektische(s) Chaos“ (W4 212) von Irrationalem und Logik, Unbewusstem und Bewusstem ausgebrochen. So „erbt“ die Kunst zumindest eine Funktion, nämlich die des „Ausdruck(s) der Differenz des Menschen mit dem Realen“ (W4 211), die des „Ausdruck(s) der Nichtübereinstimmung zwischen dem Realen und seinen Zeichen“ (W4 210). Dass das nicht zwingend zu einem „take off“ der Signifikanten führen muss, können wir am Beispiel des Bebuquin sehen. In der ästhetischen Reflexion des Kunstschönen umspielen die Vermögen dank ästhetischer Ideen bestimmte Begriffe, wie in der des Naturschönen eine Gegenstandsform.
Anmerkungen
1 Der Aufsatz Totalität ist in mehreren Teilen in „Die Aktion“ erschienen, 4. Jg. 1914, Sp. 277-279, Sp. 345-347 und Sp. 476-478. Eine zusammenhängende Publikation erfolgte erstmals unter dem Titel Totalität I-V in dem Buch „Anmerkungen“, Verlag „Die Aktion“, Berlin 1916. Zitiert wird nach der vierbändigen Werkausgabe: Carl Einstein, Werke, Band 1, 1908-1918, hg. v. Rolf-Peter Baacke. Berlin 1980, S. 223-229. Alle Texte aus der Werkausgabe werden im Folgenden unter den Siglen W1 – W4 und unter Angabe der Seitenzahl zitiert. Die eigenwillige und uneinheitliche Rechtschreibung Einsteins werde ich in den Zitaten nicht hervorheben.
2 Dirk Heißerer weist darauf hin, dass im Carl-Einstein-Archiv der Akademie der Künste Berlin eine Handschrift unter dem Titel „Picasso“ erhalten ist, die den Text des Manifests mit Korrekturen Einsteins enthält. Dies könne der Text sein, den Einstein Franz Marc für den Almanach „Der blaue Reiter“ schickte, vgl. Dirk Heißerer, Negative Dichtung. Zum Verfahren der literarischen Dekomposition bei Carl Einstein. München 1992, S. 35, Anm. 71.
3 Heidemarie Oehm spricht von dem „Konzept der Totalität“, vgl. Heidemarie Oehm, Die Kunsttheorie Carl Einsteins. München 1976, S. 19.
4 Vgl. dazu Thomas Krämer, Carl Einsteins „Bebuquin”. Romantheorie und Textkonstitution. Würzburg 1991, S. 9.
5 Nach Heißerer lässt sich Einsteins Literatur im Rahmen der „epochenspezifischen Absage an die ‘geschlossene Form’ zugunsten einer ‘offene(n) Darstellungsstruktur’“ begreifen, vgl. Heißerer 1992, S. 18. Oehm begreift das Fragmentarische „als eine wesentliche Qualität der autonomen Form“, auf die Einstein ziele, vgl. Oehm 1976, S. 38.
6 Vgl. z.B. Andreas Kramer, „Wundersüchtig”. Carl Einstein und Hugo Ball, in: Hugo Ball Almanach 13. Pirmasens 1989, S. 63-100; ders., Die „verfluchte Heredität loswerden”. Studie zu Carl Einsteins Bebuquin. Münster 1990; vgl. aber auch Krämer 1991 und Heißerer 1992.
7 Hier sind zunächst die Pioniertaten von Penkert und Oehm zu erwähnen, vgl. Sibylle Penkert, Carl Einstein. Beiträge zu einer Monographie. Göttingen 1969 und Oehm 1976. Letztere legt einen Schwerpunkt auf Nietzsche, Mach, Bergson, Fiedler, Mallarmé und William James, vgl. Oehm 1976, S. 11-13 und 40ff. Krämer z. B. beschäftigt sich ergänzend mit den Einflüssen durch Hildebrand, Novalis, Hardenberg, Schlegel, Jean Paul, Cassirer, Riegl und Worringer, vgl. Krämer 1991, S. 26-47.
8 Das gilt m.E. auch noch für die sehr gründliche und umfangreiche Arbeit von Klaus H. Kiefer, Diskurswandel im Werk Carl Einsteins. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte der europäischen Avantgarden, Niemeyer 1994. Vgl. dort dazu S. 107-109.
9 Vgl. dazu W1, „Rezensionen zu »Bebuquin«“ S. 497-504.
10 Ewald Wasmuth, Die Dilettanten des Wunders. Versuch über Carl Einsteins „Bebuquin“, in: Der Monat, 1962, H. 63, S. 51, 2. Spalte.
11 Die ersten vier Kapitel sind als Teilabdruck unter dem Titel „Herr Giorgio Bebuquin“ erschienen, in: Die Opale 2, 1907, S. 169-175. Ein vollständiger (Vor-) Abdruck erfolgte 1912 unter dem Titel Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders in: „Die Aktion“ 2.
12 Carl Einstein, Bebuquin, hg. v. Erich Kleinschmidt. Stuttgart 1985, S. 12f. Der Text wird im Folgenden unter der Sigle Be und unter Angabe der Seitenzahl zitiert.
13 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Der Text wird hier und im Folgenden unter der Sigle KrV und unter Angabe der Auflage und Seitenzahl zitiert. Auf die Kritik der Urteilskraft wird unter der Sigle KU und nach der Paginierung der 2. Auflage von 1793 verwiesen.
14 Vgl. KrV § 2, 3), B 39/A 24-B39/A 25 (5301).
15 Vgl. KrV B 71.
16 Vgl. KrV B 33/A 19-B 35/A 20.
17 Dirk Heißerer schreibt: „In seinem Aufsatz ‘Totalität’… konzentriert Einstein seine kunsttheoretischen Ansätze zu einem Schlüsselbegriff“ (Heißerer 1992, S. 35f). In anderen Texten des Zeitraums bis 1914 findet sich kein vergleichbar fundamentaler Entwurf einer Ästhetik, sondern nur eingesprengte poetologische und malereitheoretische Gedanken, vgl. „Brief über den Roman“ (1911/12), (W1 66-71) oder „Über Paul Claudel“ (1913), (W1 198-206).
18 Das erklärt die teils hilflos, teils tautologisch wirkende begriffliche Überbestimmung, die den Aufsatz so schwer lesbar sein lässt. Noch 1923 bekennt Einstein: „zu einer Fassung des seelischen des latenten, in Bereitschaft gesetzten, der Graduation, der Aktaussonderung, des Aktverschwindens etc. bin ich nie gekommen und fand auch nie eine hinreichende Beschreibung.”. Brief vom 10.XI.1923 an Ewald Wasmuth, zitiert nach Oehm 1976, S. 17.
19 In: Der Demokrat, 2, Nr. 22, 1910, zitiert nach W1 36-40. Die Übernahme dieses Ansatzes schlägt sich auch in allen Texten über den Kubismus nieder. Wir finden dort überall Bestimmungen der Form, aber keine der Farbe im Kubismus.
20 Einstein bespricht an dieser Stelle das Werk „Pflüger mit Stier”.
21 Für Kant gilt ein Ding „als Naturzweck, wenn es von sich selbst … Ursache und Wirkung ist“, KU § 64, 286.
22 Als Formbestimmung der totalen Gegenstände ist dieses Verhältnis schon im Aufsatz über „Arnold Waldschmidt“ angedeutet. Dort ist die Rede von der „Totalität der materiellen Fläche durch vollkommene Formung nach allen Seiten“ (W1 40).
23 In „Die Bildung Kunstgeschichtlicher Gesetze“ (W4 267-268) stellt Einstein fest: „(Das Kunstwerk hat eine Beständigkeit und steht als Motor) als logischer Gegenstand, insofern es immer das gleiche ist, als geschautes ist es Veränderungen unterworfen.“ (W4 267f)
24 Vgl. dazu KrV B 224-226.
25 Auch Kant merkt, dass an diesem Punkt eine Grenze erreicht ist: „Es ist merkwürdig, dass wir an Größen überhaupt a priori nur eine einzige Qualität, nämlich die Kontinuität, an aller Qualität aber (dem Realen der Erscheinungen) nichts weiter a priori, als die intensive Quantität derselben, nämlich dass sie einen Grad haben, erkennen können, alles übrige bleibt der Erfahrung überlassen.“ (KrV B 218)
26 Vgl. KrV B 105.
27 Es handelt sich hierbei um eine Handschrift, auf deren Titelblatt wir die Notiz Einsteins finden: „begonnen am 30. April 1910″, W4 122-125.
28 Vgl. KU § 43 „Von der Kunst überhaupt“, B 174; § 51 „Von der Einteilung der schönen Künste“, B 209.
29 Bei Kant heißt es nicht unähnlich, dass, um dem Kunstwerk Form zu geben, „Geschmack“ erfordert wird, an den der Künstler „sein Werk hält, und, nach manchen oft mühsamen Versuchen, denselben zu befriedigen, diejenige Form findet, die ihm Genüge tut: daher diese nicht gleichsam eine Sache der Eingebung, oder eines freien Schwunges der Gemütskräfte, sondern einer langsamen und gar peinlichen Nachbesserung ist, um sie dem Gedanken angemessen und doch der Freiheit im Spiele derselben nicht nachteilig werden zu lassen.“ (KU § 48 B 190,191).
30 Krämer vermutet, dass der Titel von Einsteins nachgelassenem Essay möglicherweise auf Worringers Darlegung des Rieglschen Standpunkts zurückgeht, die er in seiner 1908 publizierten Dissertation „Abstraktion und Einfühlung“ gibt, vgl. Krämer 1991, S. 46f.
31 Diese Handschrift ist undatiert.
32 Logik, Akademieausgabe, 33.
33 Vgl. W4 222-228.
34 Erschienen in: Hyperion, H. 8, 1909, S. 172-176. Ebenfalls in: Carl Einstein „Anmerkungen“, Verlag Die Aktion, 1916 und in: Die Aktion, 6. Jg., 1916, Sp. 405-408.
35 Den Begriff der „Parafrase“ illustriert Einstein nur: „Parafrase ist: Jemand sieht einen Fisch in einem Geschäft ausgelegt, stellt über ihn eine biologische Betrachtung an und kauft ihn für die Familie.“ (W1 167)
36 Heidemarie Oehm hat darauf hingewiesen, dass dem Wort „Kette“ im Bebuquin die Funktion einer strategischen Metapher zuwächst: „Die Worte ‘konzentrieren’, ‘Kette’ und ‘Wände’ sind nicht zufällig miteinander kombiniert. Da sich ihr Vorkommen im Roman häuft, wächst ihnen die Funktion einer strategischen Metapher zu. Über den unmittelbaren Satzkontext hinaus werden sie mit einer Bedeutung aufgeladen, die sie nicht ihrem signifikanten Wert allein verdanken, sondern die sie aus ihrer Konfiguration an anderen Stellen des Romans beziehen.“ Oehm 1976, S. 113.
37 Erschienen in: Hyperion, H. 5, 1908, S. 14-18, W1 S. 13-22.
38 Vgl. Erich Kleinschmidt, Nachwort, (Be 76).
39 Friedrich Schlegel etwa schreibt im Athenäum-Fragment 1 16 „Die romantische Poesie … kann … am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen …“ in: ders., Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe (Hg. E. Behler u.a.), München/Paderborn/Wien, II, S. 82 f. Schlegel Beschreibung ist nicht zuletzt deswegen überschwenglich, weil er die Freiheit einer sich selbst hervorbringenden Schöpfung beschreibt.
40 Der Spiegel ist im Bebuquin zugleich zu Metapher einer phantastischen Wahrnehmung, aber auch Multiplikator des Dinge gebenden Lichts, das die Souveränität des Wahrnehmens bricht. Vgl. dazu die exemplarischen Szenen im 1. Kapitel, (B 5f.), und im Zirkus, (B 44).
41 Einstein spricht sogar die Hauptfigur „Bebuquin“ als „Meier“ an: „Ich wette, Meier würde nicht unter die Gaslaterne gestellt, wenn dem Poeten irgendwelche andere Umschreibungen einfielen, z.B. das beliebte Kristall unter dem eisklaren Polarlicht der sommerliche Wasserspiegel geblendet vom durchsichtigen Leib schwimmender Fische oder die schmalen ringelastenden Hände blasser Frauen. Dies scheint nicht nötig, hingegen willkürlich und ebenso unnotwendig ist Meiers Tod. Man weiß nicht, hält Meier die lange Rede, weil er stirbt, oder stirbt er, um zu sprechen, und weil lang genug das Stück ermüdete. Aber was nicht alles vermöchte er noch statt zu sterben.“ (W1 169)
42 Es handelt sich hierbei um ein undatiertes handschriftliches Konvolut von 40 Blättern, W4 163-176.
43 Das ist später auch der Ansatz Martin Heideggers in seinem Werk Kant und das Problem der Metaphysik.
44 Deswegen soll Metaphysik nur „unseren Fähigkeiten gelten …, nicht aber als extensiv allgemeine“ (W1 225).
45 Vgl. KU § 30.
46 Vgl. dazu KU 201 und § 48 „Vom Verhältnisse des Genies zum Geschmack”.
47 Vgl. dazu die Adornos und Lyotards Stellung zum Geniebegriff kritisch akzentuierende Arbeit von Christoph Schmidt, „Die Endzeit des Genies. Zur Problematik des ästhetischen Subjekts in der (Post-)Moderne.“ In: DVjs, 1/1995, S. 172f.
48 Gleich an mehreren Fronten bemüht sich Kant darum in § 49 „Von den Vermögen des Gemüts, welche das Genie ausmachen”. Winfried Menninghaus hat den Geniebegriff und die Dialektik von Unsinn und Sinn in seinem Aufsatz „Kant über ‘Unsinn’, ‘Lachen’ und ‘Laune’“ ausführlich dargestellt, in: DVjs, Stimme, Figur. Kritik und Restitution in der Literaturwissenschaft. Sonderheft 1994. S. 263-286.
49 So heißt es in dem Nachlasstext „il se pose la question“ (W4 177-194).
Zuerst erschienen in Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 104. Jahrgang 1997, 1. Halbband, Verlag Karl Alber